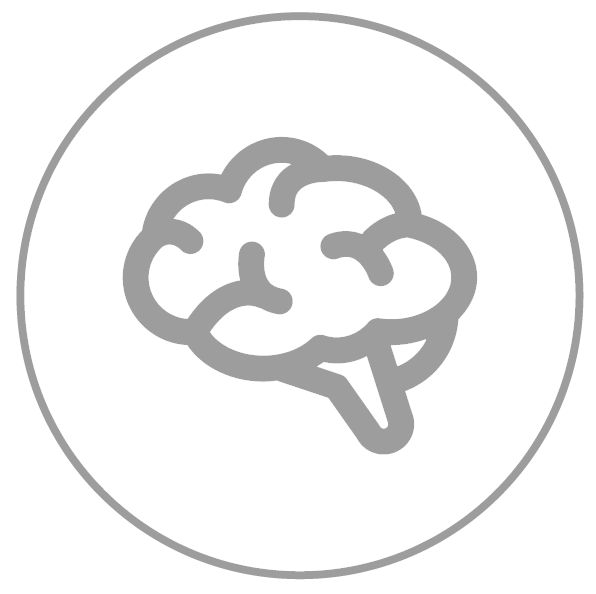Weltweit sind etwa 63 Millionen Menschen von Sehkraftverlust aufgrund von Atrophie und Neuropathie des Sehnervs betroffen, ähnlich viele leiden unter dem Verlust der Funktionalität ihrer Gliedmaßen. Derzeit gibt es nur unzureichende Behandlungsmöglichkeiten für diese behindernden Krankheiten. Das Team des EKFZ-Zentrums für Optogenetische Therapien konzentriert sich auf die Entwicklung von optogenetischen Gehirn-Computer-Schnittstellen (oBCIs) mit geschlossenem Regelkreis, die das Sehvermögen wiederherstellen und geschickte Bewegungen in Handprothesen ermöglichen sollen. Die optogenetische Manipulation von Hirnstromkreisen, die in den grundlegenden Neurowissenschaften weit verbreitet ist, befindet sich noch in der Anfangsphase ihrer Umsetzung in die klinische Praxis. Zu den Herausforderungen bei den derzeitigen kommerziellen BCIs gehören die breite Stromausbreitung und die Vernarbung des Gewebes, was die Wirksamkeit kurz nach der Implantation verringert. Die optogenetische Stimulation bietet jedoch eine räumlich begrenzte und das Gewebe durchdringende Lösung.
Team IV
Optogenetic Cortical Interfaces
Moderatoren

Dr. Marcus Jeschke

Scherberger, Hansjörg Prof. Dr.
Beschreibung
Das EKFZ für Optogenetische Therapien treibt die Entwicklung von hochdichten, geschlossenen oBCIs voran. Für die Wiederherstellung des Sehvermögens beinhaltet dies die Ausrichtung auf bestimmte Hirnareale, die trotz einer Schädigung des Sehnervs funktionsfähig bleiben, was zunächst an Modellen von Marmosetten getestet wird. Zur Wiederherstellung der motorischen und sensorischen Funktionen von Gliedmaßen beinhaltet der Ansatz die Integration von Feedback-Systemen in Prothesen, um sensorische Eingaben zu simulieren, die durch die Gehirnaktivität gesteuert werden. Diese Initiativen beinhalten eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Forschungsplattformen, um die Technologie zu verfeinern und sicherzustellen, dass sie für künftige klinische Versuche sicher und wirksam ist. Das langfristige Ziel sind umfangreiche präklinische Versuche an nichtmenschlichen Primaten, um die Voraussetzungen für klinische Tests zu schaffen.